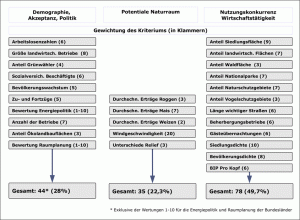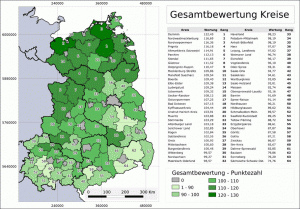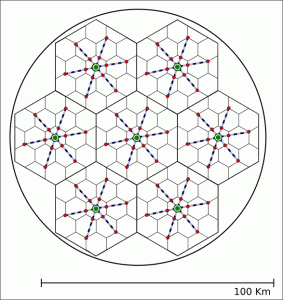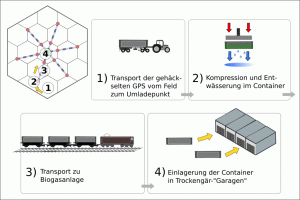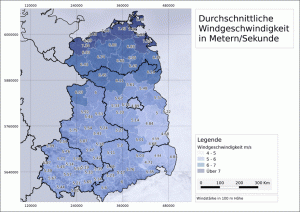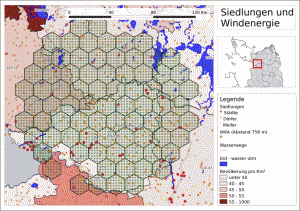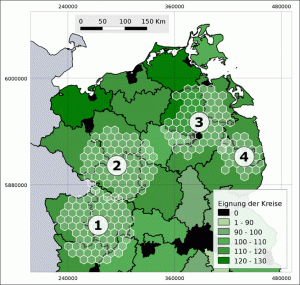by Daisymupp | Aug 8, 2011 | Energie und Klima, Erneuerbare Energien
Trotz des oberflächlichen Konsenses für die Umstellung auf ein regeneratives Energiesystem werden ambitionierte Großprojekte hierzulande derzeit ausschließlich in Form der Offshore-Windparks realisiert. Und so schreitet die Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energiequellen mit jährlich lediglich etwa einem Prozentpunkt Zuwachs voran. Bei dieser Geschwindigkeit würde es noch über 70 Jahre dauern, bis eine vollständige regenerative Stromerzeugung realisiert wäre. Und dann blieben noch die Umstellung des Verkehrssystems und der Wärmeerzeugung auf erneuerbare Energien.

Illustration: Christopher Stark. Ausgangsbilder: Soul Free, Rainer Sturm, Ra Boe, Lizenz: CC-BY-SA-3.0
Mit einer einzigen Regenerativ-Sonderzone könnte auf einen Schlag ein Fünftel des nationalen Strombedarfs gedeckt werden. Im Folgenden soll erläutert werden, wie eine solche Sonderzone in strukturschwachen Gebieten Ostdeutschlands realisiert und konkret ausgestaltet werden könnte.
Ansätze einer zukunftsorientierten ländlichen Entwicklung
Welche Zukunft steht den ländlichen Regionen Ostdeutschlands bevor? Demographisch betrachtet wird sie aller Voraussicht nach ziemlich menschenleer sein. Das Statistische Bundesamt rechnet mit einem Rückgang der Bevölkerung um knapp ein Drittel bis zum Jahr 2060. Die ostdeutschen Bundesländer wissen um diese Zahlen und erkennen weitgehend an, dass diese Entwicklung trotz verschiedener staatlicher Bemühungen wohl nicht grundlegend aufzuhalten sein wird.
Vier Möglichkeiten, mit dem Problem der Entvölkerung ganzer Landstriche umzugehen, sind vorstellbar:
- Die demographische Entwicklung wird anerkannt und es wird versucht, durch verschiedene Maßnahmen, z.B. durch Strukturanpassungen des Zentrale-Orte-Musters, die Auswirkungen abzufedern.
- Eine massenhafte Immigration von Ausländern nach Ostdeutschland wird vorangetrieben, um den demographischen Trend umzukehren
- Dörfer und ländliche Regionen nutzen den Umbau des Energiesystems hin zu erneuerbaren Energien für ihre Eigenversorgung und für die ökonomische Stabilisierung
- Die Entvölkerung wird für den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien zur Versorgung der Ballungsgebiete genutzt. Zu diesem Zweck wird eine oder werden mehrere Regenerativ-Sonderzonen errichtet.
Die zuständigen Ministerien der betroffenen Bundesländer verfolgen im Großen und Ganzen Ansatz Nr. 1, also “Weitermachen und Hoffen, dass alles nicht so schlimm wird”. Ansatz Nr. 2 wird im allgemein eher immigrations- und ausländerfeindlichen politischen Klima nicht umsetzbar sein. Ansatz Nr. 3 klingt auf den ersten Blick überzeugend, reicht aber nicht aus. Warum soll hier erörtert werden:
In der Folge der UN-Agenda 21 seit den 1990er Jahren und der sogenannten Lokalen Agenda 21 bekam die bundesdeutsche Regionalpolitik neuen Schwung und es entstanden und entstehen seither eine Vielzahl regionaler nachhaltigkeits- bzw. ökologieorientierter Entwicklungs- und Energiekonzepte. Die konsequenteste Form sind hierbei Energie-Autarkie-Regionen, z.B. sogenannte “Bioenergie-Dörfer”, die sich durch den Einsatz erneuerbarer Energien selbst versorgen.
Solche Ansätze sind zwar lobenswert und deuten in die richtige Richtung, leider taugen sie nur bedingt zur regenerativen Vollversorgung der Städte und Ballungsräume, in denen nun einmal der allergrößte Teil der Bevölkerung lebt. Neben der bestehenden Kleinstaaterei und einer ausschließlichen Fixierung auf das Lokale und Ländliche muss der Blick aber für das große Ganze geweitet werden. Nur dann können die nationalen Zielvorgaben für die Umwandlung des Energiesystems erreicht werden. Da erneuerbare Energien hierzulande sehr viel mehr Raum benötigen, als etwa Atom- und Kohlekraft, müssen die ländlichen Regionen zwangsläufig zu Stromlieferregionen für die Städte werden. Ob das nun gefällt oder nicht.
Eine Regenerativ-Sonderzone hat hier den Vorteil, dass nicht der gesamte ländliche Raum für erneuerbare Energien “umfunktioniert” werden muss, sondern nur einige, besonders wenig genutzte Gebiete. Die Idee einer Sonderzone stellt sich vor allem dem Ansatz Nr. 1 entgegen und will Ergänzung zum Ansatz Nr. 3 sein.
Bevor über das Wie, also über die Ausgestaltung einer solchen Sonderzone nachgedacht werden kann, muss zunächst das Wo erörtert werden. Schließlich ist die hohe Konzentration nur einer privilegierten Landnutzungsart regenerativer Energieerzeugung in einem Gebiet, in dem bereits andere Landnutzungen vorherrschen, schwierig zu realisieren.
Fragen der Standortfindung
Das Suchgebiet für eine Regenerativ-Sonderzone soll sich aus zweierlei Gründen auf Ostdeutschland beschränken. Zum einen leiden ostdeutsche Bundesländer, (insbesondere im ländlichen Norden) unter massiven Bevölkerungsverlusten. Zum anderen besteht eine verhältnismäßig sehr geringe Bevölkerungsdichte von häufig nur etwa 50 Personen pro km2. Die Nutzungskonkurrenz durch Industrie, Gewerbe und Wohnen ist daher vergleichsweise gering und die Zukunftsperspektiven sehen dunkel aus. Es muss nach Konzepten gesucht werden, die negative Entwicklung in diesen Regionen aufzufangen oder die Region anderweitig nutzbar zu machen.
Um in Ostdeutschland einen oder mehrere am besten geeignete Standorte für eine solche Sonderzone zu finden, bietet es sich an, eine Vielzahl unterschiedlicher statistischer, politischer und naturräumlicher Indikatoren als Grundlage zu verwenden. Mit Hilfe einer Heuristik, also einer groben, rechnerischen Suchmethode bestehend aus gewichteten Faktoren, soll die Standortfindung so weit wie möglich objektiviert werden.
Welches Kriterienbündel mit welcher Gewichtung für eine Regenerativ-Sonderzone sinnvoll erscheint, ist in der Abbildung 1 dargestellt.
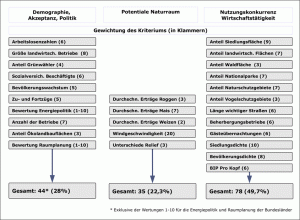
Abbildung 1: Faktoren und Gewichtung für den Standort einer Regenerativ-Sonderzone (1=niedrigste, 20=höchste Gewichtung)
Die Nutzungskonkurrenz fließt als stärkster Faktor ein. Schließlich steht und fällt die Realisierung einer Sonderzone mit diesem Faktor. Fragen der Akzeptanz, der allgemeinen politischen Landschaft und der Demographie spielen eine große Rolle, da in einer funktionierenden Demokratie nichts gegen die Bevölkerung durchgesetzt werden kann (und darf). Die demographischen Faktoren geben darüber hinaus einen Hinweis auf die mit der Zeit zunehmende Eignung der Gebiete – etwa durch eine natürliche Entsiedlung als Folge des Bevölkerungsrückgangs und der Abwanderung. Die naturräumlichen Faktoren spielen vor allem bezüglich der durchschnittlichen Windgeschwindigkeit eine Rolle.
Neben den hier dargestellten Faktoren gehen noch die allgemeine Bewertung der Raumplanung und des bisherigen Ausbaus der erneuerbaren Energien auf Landesebene als zwei kleinere Faktoren ein. Hiermit soll berücksichtigt werden, wie günstig das jeweilige politische Klima für eine Regenerativ-Sonderzone ist.
Die rechnerische Auswertung der Heuristik erfolgt auf Kreisebene, da dies die kleinste administrative Ebene ist, auf der fast alle relevanten, staatlich erfassten Statistiken verfügbar sind. Herausgenommen wurden lediglich die kreisfreien Städte, da sie für die Errichtung der hier vorgestellten Sonderzone ungeeignet sind. Aus Abbildung 2 wird ersichtlich, welche Kreise am besten und welche am schlechtesten als Standort geeignet sind (hohe Punktezahl = gute Eignung, niedrige Punktzahl = schlechte Eignung).
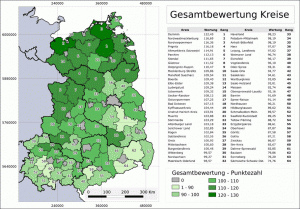
Abbildung 2: Ergebnis der Suchheuristik: Eignung der Kreise
Die günstigsten Gebiete sind nun ungefähr identifiziert. Wo ganz genau eine oder mehrere Regenerativ-Sonderzonen entstehen sollen, wird später erörtert. Zunächst soll dargelegt werden, wie die konkrete Ausgestaltung einer solchen Zone aussehen könnte.
Die Ausgestaltung einer Regenerativ-Sonderzone
In einer Regenerativ-Sonderzone sollen alle vertretbaren Potentiale erneuerbarer Energien in einem begrenzten Raum genutzt werden.
Der hier vorgestellte Ansatz verzichtet auf die Energieerzeugungsarten Photovoltaik, Geo-, Solarthermie und Wasserkraft und konzentriert sich ausschließlich auf Bio- und Windenergie. Der Grund für den Ausschluss der anderen Erzeugungsarten ist bei der Wasserkraft, dass die Potentiale bereits größtenteils ausgebaut sind und bei der Solarthermie, dass sie zur Stromerzeugung in Mitteleuropa ungeeignet ist. Die Nutzung der Photovoltaik erscheint auf Hausdächern sinnvoll, die langfristige Versiegelung landwirtschaftlicher Flächen im großen Maßstab wird vom Autor jedoch als wenig ökologisch angesehen. Zudem kann die Photovoltaik derzeit in puncto ökonomischer Effizienz (Energieoutput im Verhältnis zur Investition) noch nicht mit der Bio- und Windenergie konkurrieren. Die Geothermie ist derzeit noch nicht ökonomisch effizient und es bleibt die Frage, ob sie es in absehbarer Zeit werden wird. Insofern soll auch diese erneuerbare Energiequelle nicht Gegenstand der Betrachtung hier sein.
Im Folgenden wird dargelegt, wie Windenergie und Bioenergie möglichst effizient und sinnvoll in einer Regenerativ-Sonderzone zum Einsatz kommen können. Zunächst soll die optimale Ausgestaltung der Bioenergie-Erzeugung, dann der Windenergienutzung erläutert werden.
Bioenergie und Transportinfrastruktur
In der Bundesrepublik bestehen überwiegend dezentrale Biogas-Produktionsanlagen, welche von einem oder wenigen Landwirten betrieben werden. Meist wird die Biomasse, also die sogenannte Ganzpflanzensilage (gehäckselte ganze Pflanzen) zusammen mit Mist und oder Gülle im Nassfermentationsverfahren zu Biogas umgewandelt. Dies wird dann in einem dezentralen Blockheizkraftwerk vor Ort verbrannt und so Elektrizität erzeugt. Der Transport der Biomasse erfolgt in der Regel mit einem Traktor direkt vom Feld zur Anlage. Die zurückzulegenden Strecken liegen hierbei bei wenigen Kilometern. Bei Großanlagen wird die Biomasse zum Teil mit LKW oder auch mit Traktoren über zig Kilometer weit transportiert, was ökologisch fragwürdig ist.
In einer Regenerativ-Sonderzone muss der Transport zwar zwangsläufig über etwas größere Distanzen erfolgen als bei einem kleinen Bauernhof, jedoch kann durch den intelligenten Einsatz der effizientesten Transporttechnologien und einer optimalen Infrastruktur gewährleistet werden, dass der Energieaufwand für den Transport dennoch gering ist.
Die Sonderzone soll in zusammenhängende Einzelzonen unterteilt sein, um Transportwege zu minimieren. Als sinnvoll erscheint die Segmentierung in eine Sechseck-Wabenstruktur mit zwei Hierarchiestufen – in sieben große Sechsecke, welche jeweils sechzehn 10-km-Sechseckzonen enthalten. Eine solche Raumunterteilung ist ganz frei der Theorie der Zentralen Orte des Geographen Walter Christaller (1893 – 1963) entlehnt.[1]
Innerhalb jeder der kleinen Sechseck-Zonen mit einer Breite von 10 km von Ecke zu Ecke beträgt die durchschnittliche für Biomasse zurückzulegende Distanz ca. 4,12 km. Dies ist die Distanz, die von einem LKW oder Traktor zurückgelegt werden muss, bis die Biomasse an einem Umladepunkt auf die Schiene verladen wird, um zur zentralen Biogasanlage in einem der großen Sechseck-Zonen zu gelangen (siehe Abbildungen 3 und 4).
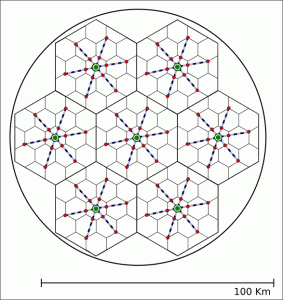
Abbildung 3: Infrastruktur der Sonderzone und Einteilung in Sechseck-Zonen.
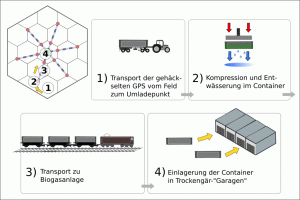
Abbildung 4: Schematische Darstellung des Transportes der Biomasse hin zur Biogasanlage.
Bei der hier vorgeschlagenen Regenerativ-Sonderzone mit einem Gesamtdurchmesser von etwa 100 km bestünde die oben erörterte Transport-Infrastruktur aus 7 dezentralen Biogasanlagen (grüne Punkte). Durch die umgebenden Waben würden dann jeweils drei gerade Gleisabschnitte (gestrichelte Linien) führen, die jede der sechzehn 10-km-Sechseck-Waben an einem Punkt berühren.
Der in Abbildung 4 schematisch dargestellte Abtransport der Biomasse soll vom Umladepunkt aus (rote Punkte) durch den Einsatz eines Güterzugs erfolgen, da der Rollwiderstand der Gleise erheblich geringer ist als Reifen auf einer Straße. Der Zug ist auf dem Land das energieeffizienteste Transportmittel. Dies gilt insbesondere für Elektroloks, die gegenüber Dieselloks über einen deutlich höheren energetischen Wirkungsgrad verfügen. Elektroloks können in einer Regenerativ-Sonderzone mit dem erzeugten Ökostrom betrieben werden. Da der genaue Zeitpunkt der Biomassetransporte hin zur Biogasanlage nicht auf die Stunde oder den Tag genau erfolgen muss, so kann die Bahn für die Transporte zu Starkwindzeiten fahren, um weniger Energiespeicherung notwendig zu machen.
Um das Transportgewicht und -volumen deutlich zu reduzieren, muss die Biomasse gehäckselt und entwässert werden. Das Häckseln geschieht sinnvollerweise direkt auf dem Feld bei der Ernte und die Entwässerung kann im Bahnwaggon, wie in Abbildung 4 simplifiziert dargestellt, erfolgen.
Neben einer effizienten Transportinfrastruktur sprechen auch weitere Aspekte für die Produktion von Bioenergie innerhalb einer Sonderzone: So kann hier durch die großen Mengen erzeugten Biogases eine höhere energetische Effizienz durch den Einsatz eines zentralen Gas-und-Dampf (GuD) Kraftwerks an Stelle dezentraler Blockheizkraftwerke realisiert werden. Die Stromerzeugungsleistung steigt hier auf knapp 60% – gegenüber etwas unter 40% bei Blockheizkraftwerken. Auch sind Großanlagen deutlich günstiger in Bau und Betrieb und weisen weniger Verluste auf als eine Vielzahl kleiner Anlagen. Das GuD-Kraftwerk kann neben Biogas auch Wasserstoff aus der Speicherung überschüssigen Windstroms mitverbrennen.
An Stelle der meist eingesetzten Nassfermentation soll ausschließlich auf die Trockenfermentation gesetzt werden. Hier werden nur pflanzliche Stoffe (ohne Mist und Gülle) in Biogas umgewandelt. Vorteile dieses Verfahrens sind geringere Wärmeverluste beim Gärprozess und ein einfacherer Umgang mit der Biomasse in der Biogasanlage (die Biomasse kann direkt im Transportcontainer verbleiben und dort in Biogas umgewandelt werden).
Die bei der Biogaserzeugung anfallenden Gärreste können zu landwirtschaftlichem Dünger weiterverarbeitet oder direkt als Dünger wieder auf die Felder gebracht werden. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die dann höhere Gesamteffizienz der Energienutzung sinnvoll. Ausserdem muss so erheblich weniger klimaschädlicher Stickstoffdünger eingesetzt werden.
Um die ökologische Nachhaltigkeit zu garantieren, muss die Fläche des Maisanbaus in einer Regenerativ-Sonderzone begrenzt werden. Aufgrund der hohen Eignung von Mais für die Biogasproduktion könnte es sonst zu einer Ausweitung von Monokulturen kommen. Der Maisanbau könnte auf 50% aller landwirtschaftlicher Flächen begrenzt werden. Eine Mindestquote für den Anbau von mehrjährigem Agrarholz bzw. Kurzumtriebsplantagen (z.B. 10-20%) und für Winterroggen (z.B. 20%) könnte die ökologische Verträglichkeit ergänzen – je nach den naturräumlichen Begebenheiten im jeweiligen Sonderzonengebiet. Darüber hinaus sollten breite Ackerrandstreifen im Sinne des Artenschutzes und des Landschaftsbildes dort hinzugefügt werden, wo sie bisher fehlen oder dort wo die Felder sehr groß sind.
Die Ausgestaltung einer Regenerativ-Sonderzone: Windenergie
Die Windenergie ist neben der Wasserkraft und der Solarthermie die derzeit am weitesten entwickelte regenerative Energieerzeugungsart. Sie ist hierbei im Gegensatz zu den beiden erstgenannten flächendeckend im Gebiet Ostdeutschlands einsetzbar.
Der Ausbau der Windenergie findet hierzulande in “Eignungsgebieten” statt. In anderen Gebieten dürfen keine Windkraftanlagen errichtet werden. Die Eignungsgebiete sind meist sehr klein im Bereich von Hektarn und selten wesentlich größer. Die Regenerativ-Sonderzone soll mit einigen Einschränkungen ein einziges Eignungsgebiet sein.
Um die Windkraftanlagen in den Binnenlandstandorten effizient betreiben zu können, insbesondere im mittleren oder südlichen Ostdeutschland mit durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten von 4 bis 5 m/s, darf es keine Höhenbegrenzung in einer Sonderzone geben.
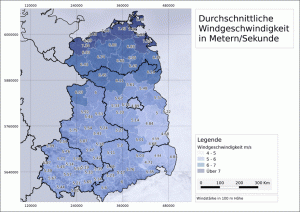
Abbildung 5: Durchschnittliche Windgeschwindigkeiten in Ostdeutschland
Der Grund ist, dass je höher die Windkraftanlagen sind, sie desto mehr Energie erzeugen (allerdings mit abnehmendem Zuwachs). Der Unterschied zwischen einem Windkraftwerk mit einer Nabenhöhe von 100 Metern zu einem mit 160 Metern Höhe beträgt auf das Jahr gerechnet im Inland etwa ein Viertel des Energieoutputs.
Bisher gibt es lediglich Gittermasten aus Stahl, die bis zu einer Höhe von 160 Meter reichen. Der Materialeinsatz von Gittermasten ist deutlich geringer als bei klassisch eingesetzten Stahltürmen oder Beton-Stahl-Hybridtürmen und sie können nach dem Rückbau vollständig verwertet werden. In einer Regenerativ-Sonderzone sollen derartige Gittermasten in Kombination mit sehr großen 6 MW Windkraftanlagen zum Einsatz kommen. Die Anlagen sollen in einem gleichmäßigen Muster in technisch optimalen Abständen von 756 Metern (sechs Rotordurchmesser Distanz) zueinander errichtet werden. Dies entspricht einer Gesamtzahl von 115,4 Anlagen pro 10-Km-Sechseckzone.
Der Abstand der WKA zueinander darf grundsätzlich nicht zu gering sein, da es sonst zu Abschattungen und Luftverwirbelungen kommt, was sich wiederum negativ auf die Erträge und die Haltbarkeit der Anlagen auswirkt. Durch Abschattungseffekte liegt der gesamte Ertrag eines Windparks (“Parkwirkungsgrad”) mit Abständen von fünf Rotordurchmessern z.B. um etwa 12% niedriger, als wenn es keine Abschattungseffekte gäbe. Durch den Bau unterschiedlich hoher benachbarter Windkraftanlagen (etwa abwechselnd 130 m und 160 m) können die Abschattungseffekte reduziert werden, sofern sie an bestimmten Stellen zu hoch sein sollten.
Abbildung 6 zeigt die Dichte von Windkraftanlagen innerhalb einer der vorgeschlagenen Sonderzonen-Standorte. Wie eine Koexistenz intensiver Wind- und Bioenergienutzung und der vor Ort ansässigen Bevölkerung bestehen kann, soll im folgenden Kapitel zur Akzeptanz diskutiert werden.
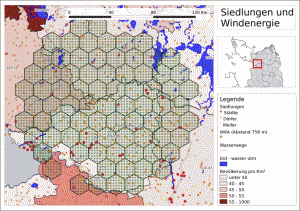
Abbildung 6: Darstellung der einzelnen Standorte für Windkraftanlagen (grüne Punkte) und Ortschaften (orange/gelbe Punkte) in einer exemplarischen Regenerativ-Sonderzone
Energiespeicherung und Netzausbau
Neben dem Ausbau der erneuerbaren Energieträger selber und der Transportinfrastruktur ist auch der Ausbau der Stromnetze unabdingbar, wenn eine Regenerativ-Sonderzone mit zig Gigawatt Leistung ins bestehende Netz integriert werden soll. Konkret hieße dies, dass neue Höchstspannungsleitungen gebaut werden müssten.
Um Widerstände der Bevölkerung gar nicht erst entstehen zu lassen und andere negative soziale Kosten durch Oberleitungen zu minimieren, sollen vor allem bestehende Hochspannungstrassen ausgebaut werden. Dies kann geschehen, indem alte Leitungen an den selben Masten durch moderne Hochtemperaturleitungen mit einer 60% bis 100% höheren Kapazität ausgetauscht werden. Sollten weitere Trassen notwendig werden, so sind diese unterirdisch zu verlegen, da solche Leitungen langfristig günstiger in der Wartung sind und ökologisch weniger schädlich.
Ein weiterer wichtiger Aspekt, der geregelt werden müsste, ist die Energiespeicherung. Da die Leistung der eingesetzten Windenergie zufällig schwankt, die Stromnachfrage aber jeden Tag in etwa gleich verläuft, muss sowohl mit der Speicherung von Biogas, als auch mit der Speicherung überschüssigen Stroms, der in Starkwindzeiten anfällt (und nicht ins Netz eingespeist werden kann), entgegengesteuert werden. Das produzierte Biogas und die im Speicher befindliche Energie werden in Zeiten geringer Windgeschwindigkeiten eingespeist. Zu den anderen Zeiten produziert fast ausschließlich der Wind die Elektrizität. Diese ergänzende Kombination unterschiedlicher erneuerbarer Energieerzeugungsarten wird Kombikraftwerk genannt.
Die Speicherung der überschüssigen Windenergie bei hohem Windaufkommen kann entweder in einem Pumpspeicherkraftwerk mit Wasser, durch die unterirdische Speicherung von komprimierter Luft oder die Umwandlung des Stroms in Wasserstoff erfolgen.
Finanzierung, Eigentümerstruktur
Insgesamt ist mit einem riesigen Investitionsbedarf in Höhe einer schätzungsweise zweistelligen Milliardensumme für die Errichtung einer Regenerativ-Sonderzone zu rechnen. Daher müsste für die Finanzierung über die beschriebenen regionalen Strukturen hinaus eine nationale Finanzierungsstrategie bestehen – möglicherweise mit Unterstützung der Bundesregierung.
Im Sinne der Akzeptanz ist es wichtig, Finanzierungsinstrumente für eine Sonderzone zu nutzen, die langfristig und stabil sind. Die Abhängigkeit vom stark schwankenden und wenig zuverlässigen internationalen Aktien- und Finanzsystem sollte daher vermieden werden.
Bei anderen großmaßstäbigen erneuerbaren Erzeugungsstrukturen (wie etwa der Offshore-Windenergie) tritt das Energiekartell (En.BW, Vattenfall, RWE und e.on) in Erscheinung. Als Investoren oder Teilhaber einer Regenerativ-Sonderzone sollen sie herausgehalten werden. Nur so kann die Oligopolmacht und Preisdiktatur dieser Unternehmen langfristig gebrochen werden. Auch das rein renditeorientierte Verhalten dieser Unternehmen, welches am anti-ökologischen Kurs des Ausbaus der Kohlekraft und dem Festhalten an der Atomenergie deutlich wird, unterstreicht diese Notwendigkeit.
Ebenso wie die Finanzierung nicht durch große Einzelakteure dominiert werden darf, soll auch die Gesellschaftsform nicht hierarchisch und von oben herab gelenkt sein. Das Modell der Genossenschaft könnte für eine Regenerativ-Sonderzone die günstigste Variante sein. Die Genossenschaft hat den Vorteil, dass sich in ihr verschiedenste Akteure engagieren können: von privaten Investoren, über Bewohner oder Landwirte vor Ort, bis zu Personen aus der Regionalpolitik. Hierbei hat jede Partei das gleiche Stimmrecht. In Befragungen wird das Genossenschaftsmodell in ländlichen Gebieten meist verhältnismäßig positiv bewertet, was für eine Umsetzbarkeit insgesamt positiv zu bewerten ist.
Ein Investitions-Kooperationsprojekt aus einer zu gründenden Genossenschaft,und bereits bestehenden bundesweit agierenden Ökostrom-Genossenschaften wäre eine weitere Möglichkeit, Kapital und Fachwissen einzubringen.
Nutzungskonflikte, Akzeptanz und Lösungsmöglichkeiten
Auch in den dünn besiedelten, ländlichen Gebieten Ostdeutschlands besteht eine hohe Landnutzungskonkurrenz von erneuerbaren Energien und verschiedenen anderen Nutzungsarten. Daneben bestehen Gesetze und Planungsvorschriften, welche auf kommunaler sowie auf Landes- und Bundesebene zu berücksichtigen sind. Diese Voraussetzungen machen es nicht leicht, wie hier vorgeschlagen, einen “großen Wurf” zu realisieren.
Die wichtigsten Landnutzungskonkurrenzen stellen neben Siedlungen unterschiedlich restriktive Schutzgebiete dar, vor allem Naturschutzgebiete und Nationalparks, in denen weder Landwirtschaft, noch Windkraftanlagen betrieben werden dürfen. Weitere wichtige Nutzungskonkurrenzen sind Gewässer und Infrastruktur wie Hochspannungsmasten oder Straßen. Zu vielen dieser Landschaftselemente bestehen Mindestabstandspflichten, vor allem für die Windenergienutzung, von meist einigen hundert Metern bis etwa 1 km.
In Abbildung 7 sind alle wesentlichen Gebiete, in denen eine Sonderzone nicht errichtet werden darf, rot eingefärbt. Die grünen Flächen repräsentieren die nutzbaren Gebiete, die gelben und andersfarbigen Gebiete können theoretisch genutzt werden. Hier wäre dies aber aufgrund des Vorhandenseins (weniger restriktiver) Schutzgebiete eventuell umstritten. Die Nutzung erneuerbarer Energien ist in den grünen Gebieten im Prinzip nur durch Siedlungen, Infrastruktur und vereinzelte Landschaftselemente wie Gewässer eingeschränkt.
Um die “grünen” und andersfarbigen Gebiete wie z.B. Landschaftsschutzgebiete wirklich für eine Regenerativ-Sonderzone nutzen zu können, müsste die Bundesregierung aktiv werden. Konkret heißt das, dass es für die Realisierung eines Bundesgesetzes bedarf, welches die Blockaden auf regionaler und auf Ebene des betroffenen Bundeslandes löst und eine unbürokratische Lösung ermöglicht. Ein solches Gesetz müsste auch eine Ausnahme von bestehenden Abstandsregelungen für diesen begrenzten Raum sowie die Aufhebung der dort geltenden Imissionsschutzrichtlinien erwirken. Auch Lösungen einer teilweisen oder vollständigen Entsiedlung bzw. Entschädigungen könnten in einem solchen Gesetz verankert werden, ähnlich wie im Bundesberggesetz.

Abbildung 7: Vier mögliche Sonderzonenstandorte und relevante Schutzgebiete
Die ungefähren möglichen Lagen für eine oder mehrere Sonderzonen sind in Abbildung 7 dargestellt. Die Modularität der Unterteilung in Sechsecke lässt es hierbei zu, einzelne 10-Km-Sechseckmodule herauszunehmen, sofern sie über einem besonders schützenswerten Gebiet oder einer größeren Siedlung liegen. So sind auch die in Abbildungen 7 und 9 dargestellten Vorschläge für Sonderzonen nicht kreisrund, sondern “angeknabbert”. Natürlich wäre es auch vorstellbar, alle grünen Bereiche zur Sonderzone zu machen, jedoch ist die hohe räumliche Konzentration im Hinblick auf den Ausbau der speziellen Infrastruktur von Vorteil. Der Grund, weshalb keine der Sonderzonen direkt bis an die Ostsee heranreicht, ist, daß diese Gebiete stark touristisch genutzt sind und somit trotz ihrer theoretischen Eignung für eine Sonderzone ausgeschlossen werden sollen (der Tourismus ist schließlich ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region).
Die Frage, wie im Falle einer konkreten Umsetzung mit Einzelkonflikten umgegangen werden kann, soll anhand der vier Beispiele in Abbildung 8 aufgezeigt werden.
Wie hier unschwer erkennbar ist, bestehen trotz der vergleichsweise niedrigen Siedlungsdichte einige Flächenkonkurrenzen zwischen Siedlungen (kleine, orange Punkte) und Windkraftanlagen (apfelgrüne Punkte). Für die betrachteten 10-Km-Sechseckzonen mit einer Fläche von 64,95 km2 ergeben sich jeweils etwa zwischen zwei und fünfzehn Überschneidungen von Windkraftstandorten und Siedlungen oder anderen Landschaftselementen (unmittelbare Nachbarschaft oder Überschneidung).

Abbildung 8: Pragmatischer Umgang mit auftretenden Raumnutzungskonflikten
Bei Beispiel Nr. 1 besteht Raumnutzungskonkurrenz zwischen zwei Windkraftanlagen und zwei Weilern, einer Straße (rot) und einem See. Die untere WKA am See könnte unter Inkaufnahme eines etwas geringeren Parkwirkungsgrads stattdessen 50 m weiter nordwestlich errichtet werden. Die obere Windkraftanlage, welche möglicherweise zu nah (weniger als eine Nabenhöhe Distanz) an der Straße steht, könnte dementsprechend 50 m weiter südlich errichtet werden. Die Abstände zu den Weilern betrügen dann in beiden Fällen etwas mehr als der Sicherheitsabstand einer Nabenhöhe. Bei Aufhebung der geltenden Abstandsregelungen in der Sonderzone wäre hier aber auch ein geringerer Abstand möglich.
Bei Beispiel Nr. 2 besteht ein möglicherweise zu geringer Abstand zu einem Dorf. Da mehr Menschen in einem Dorf wohnen als in einem Weiler, ist hier auch mehr Rücksicht zu nehmen. Der Bau dieser Anlage könnte entweder ganz entfallen oder ihr geplanter Standort könnte, wiederum unter Inkaufnahme eines geringeren Parkwirkungsgrads, um 100 m weiter nach Norden verlegt werden. Bei den Beispielen Nr. 3 und Nr. 4 sind Straßen, eine größere Siedlung und ein kleiner Fluss vorhanden. Auch hier könnte die geringfügige Verschiebung oder ein Wegfall dieser Anlagenstandorte erfolgen.
Dies sind theoretische Beispiele. Bei einer tatsächlichen Umsetzung einer Sonderzone wäre vor allem aber auch mit dem Konfliktfaktor Zivilgesellschaft zu rechnen, der sehr viel komplexere Problemstellungen aufwirft und dem mit technokratischen Lösungsansätzen nicht beizukommen ist (siehe auch Stuttgart 21).
Es geht also um die Frage der Akzeptanz. Der einfachste Weg, die Bewohner des Gebietes einer Regenerativ-Sonderzone zu überzeugen, dürften finanzielle Entschädigungen sein. Solche könnten für alle Anwohner auf Dauer gezahlt werden. Aufgrund der äußerst geringen Bevölkerungsdichte in den betrachteten Gebieten von etwa 50 Einwohnern je Quadratkilometer wären Entschädigungszahlungen eine realistische Option. Wenn zum Beispiel ein Cent je produzierter Kilowattstunde innerhalb der Sonderzone als Entschädigung an die Bewohner gezahlt würde, dann bedeutete dies eine Summe von etwa 5.645 Euro pro Jahr und Bewohner bzw. 22.580 Euro für eine vierköpfige Familie.[2]
Am meisten Geld an der Windenergie würden Landwirte verdienen. Bei einer Pacht von etwa 18.000 Euro pro WKA im Jahr und der geplanten extrem hohen Dichte von Anlagen, dürfte das für die betroffenen Landwirte beträchtliche Mehreinnahmen bedeuten.
Natürlich wird all das Geld am Ende nicht alle überzeugen. Zum Beispiel wohlhabende Menschen, die bewusst in die Einöde ziehen, um die “ungestörte Natur” zu genießen.
Die Konfliktpotentiale der Bioenergie dürften geringer ausfallen, da bereits Landwirtschaft in diesen Gebieten betrieben wird und sich lediglich der Anbau der Feldfrüchte etwas ändern würde. Hauptproblem dürfte hier sein, dass Landwirte einen Teil ihrer Eigenständigkeit aufgeben müssten.
Das häufig gegen die Bioenergie ins Spiel gebrachte Argument, der Anbau von Pflanzen für die Energiegewinnung sei eine Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion, dürfte bei Landwirten die mit Bioenergie besser verdienen als mit Nahrungsmitteln, keine so große Rolle spielen. Um dennoch kurz auf diesen Punkt einzugehen: Über 60% der landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland werden zur Futtermittelproduktion verschwendet. Halbierte man den gesamtgesellschaftlich und ökologisch fragwürdigen Fleischkonsum durch politische Maßnahmen (etwa durch eine Strafsteuer), so könnten entsprechend knapp 30% der Flächen frei werden – ein Teil davon könnte problemlos für die Bioenergiegewinnung genutzt werden und es bliebe immer noch genug Fläche für zusätzliche Ackerrandstreifen, neue Ökolandbauflächen oder sogar neue Naturschutzgebiete.
Schwieriger dürfte es wie gesagt sein, alle Landwirte davon zu überzeugen, bei einer mehr oder weniger “von oben” initiierten Sonderzone mitzumachen, insbesondere dann, wenn sie schlechte Erinnerungen an die rücksichtslose Enteignungs- und Bevormundungspolitik der DDR im Bereich der Landwirtschaft haben.
Die Fragen der Akzeptanz können an dieser Stelle nicht abschließend geklärt werden. Wesentliche finanzielle Mehreinnahmen und die tatsächliche Beteiligung der Bewohner am Planungs- und Entscheidungsprozess, dürften aber zwei wesentliche Schlüssel für die Umsetzbarkeit sein.
Was bringt die Sonderzone?
Die Erträge, welche mit einer Regenerativ-Sonderzone zu erwirtschaften sind, schwanken bei den hier dargestellten Vorschlägen zwischen 40 und 115 TWh pro Jahr. Bei einer gesamten Bruttostromerzeugung in Deutschland von etwa 597 Terawattstunden (2009), würde dies für die größte hier dargestellte Sonderzone, Vorschlag Nr. 2, einen Anteil der nationalen Stromerzeugung von 19,5% bedeuten. Bei Realisierung aller vier Vorschläge könnte etwas über 60% des gesamten Stromerzeugung erreicht werden. Zusätzlich fällt z. B. bei Vorschlag Nr. 2 eine Wärmeleistung von 390 MW an, welche für die Fernwärmeversorgung eines Ballungsgebietes genutzt werden kann.
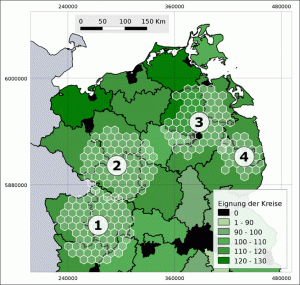
Abbildung 9: Eignung für eine Regenerativ-Sonderzone auf Kreisebene und mögliche Standorte
Die in der Tabelle 1 aufgestellte Potentialberechnung geht von verschiedenen Einschränkungen in der Flächennutzung aus, die hier erläutert werden sollen: Die ausschöpfbaren Potentiale der Bioenergie in der Sonderzone ergeben sich aus folgender Rechnung: Alle landwirtschaftlichen Flächen im Gebiet sollen vollständig für Energiepflanzen genutzt werden, abzüglich 15% für Ackerrandstreifen und den Ausbau der ökologischen Landwirtschaft.
Für die Windenergie errechnen sich die Potentiale aus allen Flächen der Sonderzone, abzüglich Siedlungsgsflächen und abzüglich pauschal 10% der Fläche, da mit weiteren kleinräumigen Hindernissen, etwa Gewässern, einzelnen Häusern oder anderweitig hinderlichen Raumelementen zu rechnen ist.
| Tabelle 1: Potentiale verschiedener Sonderzonen-Vorschläge |
| Sonderzone – |
Vorschlag 1 |
Vorschlag 2 |
Vorschlag 3 |
Vorschlag 4 |
| Zahl der Sechseck-Zonen |
78 |
78 |
67 |
27 |
| Flächen Windenergie |
| Abzug: Siedlungsflächen |
-7% bis -10% |
-6% bis -8% |
-6% bis -8% |
-6% |
Abzug: nicht nutzbarer Flächen von
der Gesamtfläche |
-10% |
-10% |
-10% |
-10% |
| Insgesamt nutzbare Fläche Wind |
81% bis 84% |
83% bis 85% |
83% bis 85% |
84% bis 85% |
| Flächen Bioenergie |
| Flächenanteil Landwirtschaft |
57% bis 69% |
52% bis 68% |
50% bis 74% |
50% bis 63% |
Abzugsflächen für Rückzugsflächen
und Ökolandbau |
-15% |
-15% |
-15% |
-15% |
| Insgesamt nutzbare Fläche Bioenergie |
49% bis 58% |
44% bis 58% |
42% bis 63% |
42% bis 54% |
| Ertragspotentiale |
| Windenergie TWh/a
(installierte Leistung) |
108,3
(44,7 GW) |
109,8
(45,3 GW) |
94,6
(39,1 GW) |
38,2
(15,8 GW) |
| Bioenergie TWh/a Strom / Wärme
(Ges. elektrische- / Wärmeleistung in GW) |
7,0 / 4,7
(0,59 / 0,39) |
6,8 / 4,5
(0,57 / 0,38) |
5,9 / 3,9
(0,50 / 0,33) |
2,2 / 1,5
(0,18 / 0,12) |
| Jährliche Stromerträge
(installierte Leistung) |
115,3 TWh
(45,3 GW) |
116,5 TWh
(45,9 GW) |
100,1 TWh
(39,6 GW) |
40,4 TWh
(16,0 GW) |
| Anteil an nationaler Stromerzeugung |
19,3% |
19,5% |
16,8% |
6,8% |
Zum Schluss…
Die Umstellung des Energiesystems auf erneuerbare Energien benötigt Raum, der in einem dicht besiedelten Land knapp ist. Um die Vollversorgung der Ballungsräume mit regenerativer Energie in Zukunft zu ermöglichen, wird man mittelfristig nicht umhinkommen, große, bisher ungenutzte Landesteile im ländlichen Raum für die Energiegewinnung umzunutzen. Das Entwicklungstempo muss im Hinblick auf die Regenerativ-Ausbauziele stark erhöht werden. Dies bedeutet auch, dass an die Stelle regionalistischer Kleinstaaterei eine stärker gesamtgesellschaftlich orientierte Perspektive treten muss – schließlich ist auch die Energieversorgung überregional.
Die Errichtung einer oder mehrerer Regenerativ-Sonderzonen ist zugleich eine vielversprechende Chance für ländliche Gebiete und eine Möglichkeit, die politisch gesetzten Ziele hin zu einer Vollversorgung mit erneuerbaren Energien zu erreichen.
Auch wenn die Realisierung hierzulande aufgrund der angesprochenen Widerstandspotentiale und der hohen Landnutzungsdichte nicht erfolgen sollte, so kann das Konzept als Beitrag zur allgemeinen Diskussion um erneuerbare Energien gesehen werden.
Vielleicht hat die Regenerativ-Sonderzone hierzulande auch erst in Zukunft eine Chance, wenn der demographische Wandel in den ländlichen Räumen Ostdeutschlands das Problem der Nutzungskonkurrenz durch menschliche Aktivitäten gelöst hat.
Quelle: ‘Möglichkeiten der ökologisch und ökonomisch sinnvollen Abgrenzung und Ausgestaltung einer “Regenerativ-Sonderzone” zur ausschließlichen Erzeugung erneuerbarer Energie in strukturschwachen Gebieten Ostdeutschlands’ (Diplomarbeit, Fachbereich Geographie an der Universität Hamburg, Dezember 2010/Christopher Stark). Siehe auch www.christopherstark.de/diplomarbeit. Weitere Quellen im Literaturverzeichnis der Diplomarbeit.
Dieser Text sowie die zugrundeliegende Diplomarbeit mit all den dargestellten Grafiken und Karten sind unter der folgenden Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: CC-BY-SA-3.0.
Text übernommen von http://www.heise.de/tp/artikel/35/35250/1.html in Telepolis > Energie

by Daisymupp | Aug 2, 2011 | Energie und Klima, Erneuerbare Energien
Gegenseitige Entwicklungshilfe in Sachen Erneuerbare Energien bei den großen Konzernen. EnBW, E.ON, RWE und Vattenfall liefern bisher zwar 70 % des Stroms, ihr Ökostrom-Anteil liegt aber immer noch im einstelligen Prozentbereich. Es gibt also noch viel zu tun, damit er bis 2020 auf 35% steigt. Jetzt hat sich RWE mit dem größten Stromverbraucher im Land, der Deutschen Bahn, zusammengetan. Denn beide haben nach dem Atomausstieg ein gemeinsames Problem, sie müssen den Atomstromanteil ersetzen und ihren Anteil an Erneuerbaren ausbauen.
Energie: Abschied vom Atomstrom bei der Bahn
Atomausstieg nun auch bei der Bahn. Letzte Woche wurde bekanntgegeben, dass in Zukunft der Atomstromanteil durch Wasserkraft auch aus neuen Laufwasserkraftwerken sowie neuen Pumpspeichern ersetzt werden soll. Weil die Bahn 90% ihrer Streckenkilometer mit elektrischem Antrieb erbringt, hatte sie zwar schon bisher einen Bonus als umweltfreundliches Verkehrsmittel. Doch kaum bekannt ist, dass 58% des Bahnstroms aus Kohlekraftwerken stammen und noch vor zwei Jahren der Atomstromanteil bei überproportional hohen 28% lag.
Zuletzt wurde noch groß investiert in ein eigenes Umrichterwerk am AKW Neckarwestheim, das ab 2012 in Betrieb gehen sollte. Greenpeace hat berechnet, dass die Stromproduktion für die Bahn allein im AKW Neckarwestheim bisher 110 Tonnen hochradioaktiven Müll verursacht hat. Bahnchef Rüdiger Grube, 2010 noch einer der Unterzeichner eines in Tageszeitungen veröffentlichten Appells an die Bundesregierung, die Laufzeiten der Atomkraftwerke zu verlängern, gab jetzt seine Wandlung vom Saulus zum Paulus bekannt.
Er sei durch durch Fukushima “in hohem Maße sensibilisiert” worden, die Bahn werde aus der Nutzung des Atomstroms aussteigen und stattdessen mehr Wasserkraft nutzen. Es bleibt ihm auch nichts anderes übrig, möchte man sagen, denn mit dem Wegfall der Atomkraftwerke muss die Bahn sich nach neuen Stromlieferanten umsehen. Sie hat nun die Chance, tatsächlich nicht nur lokal emissionsfrei, sondern wirklich nachhaltig zu fahren.
In einem ersten Schritt wurde für die Jahre 2014 bis 2018 die Lieferung von Strom aus bestehenden RWE-Wasserkraftwerken vereinbart. Der Grünstromanteil am Bahn-Strommix erhöht sich damit auf 28 Prozent. Das nächste Ziel liegt bei 30 bis 35 % im Jahr 2020. Bis 2050 soll die Bahn dann vollständig erneuerbar fahren. Insgesamt 14 Wasserkraftwerke an Rhein, Ruhr, Saar, Mosel und Ruhr werden ab 2014 jährlich 900 Mio. kWh Strom an die Deutsche Bahn liefern. Genug, um um 1/3 der IC- und ICE-Flotte zu betreiben. Im Moment hat die Deutsche Bahn noch einen Wasserkraftanteil von 17,3 %.

Energiewende ohne den Verkehrssektor geht nicht. Er ist weiter der größte Energiekonsument. Straßen- und Flugverkehr sind immer noch fast ausschließlich fossil ölbasiert. Und die Bahn ist der größte Stromverbraucher im Land. Ihr Strommix bestand bisher vor allem aus Kohle- und Atomstrom. Jetzt muß sie sich nach Alternativen umsehen. Bild: AG-Energiebilanzen
Das Unternehmen hat seit fast 100 Jahren sogar schon eigene Wasserkraftwerke (seit 1899 das Kraftwerk Kammerl im Oberammergau und seit 1914 das Kraftwerk Bad Reichenhall). Doch seitdem hat sich in Sachen Ökostrom nicht mehr viel getan. Lediglich die Beteiligung an zwei brandenburgischen Windparks trägt schon 74 Mio. kWh bei. Ansonsten macht auch im Jahr 10 nach Einführung des EEG Strom aus Wind, Sonne und Biomasse nur 2,5 % des Bahnstroms aus. Michael Ziesak vom Verkehrsclub Deutschland bezeichnete den Vertrag mit RWE als ein gutes Signal für die Branche, aber noch nicht als Meilenstein, denn gleichzeitig halte die Bahn auch am Neubau des Steinkohlekraftwerks Datteln 4 fest, gedenke also weiter, vor allem mit Kohlestrom zu fahren.
RWE seinerseits ist daran interessiert, von seinem Image als Kohle- und Atomstromkonzern wegzukommen. Der Nachholbedarf ist groß, der Anteil Erneuerbarer an der RWE-Stromerzeugung liegt gerade einmal bei 2,6 %.
Nach dem Deal mit der Bahn (1 Mrd. Euro in 4 Jahren) ist jetzt Geld für die Modernisierung da. Jürgen Großmann von RWE gibt zu bedenken, dass die herkömmliche Wasserkraft (Laufwasserkraftwerke, Stauseen) in Deutschland schon relativ weit ausgeknautscht sei und der Konzern die größeren Wachstumspotentiale daher in Osteuropa und Südosteuropa sehe. In Deutschland ist dagegen vorgesehen, bestehende Wasserkraftwerke zu repowern und neue Techniken zu erproben, u.a. auch die Kombination aus Windkraft mit dezentralen Pumspeicherkraftwerken.

Das geplante Pumpspeicherkraftwerk auf der Abraumhalde Sundern bei Hamm/Westfalen. Die Fläche der Halde beträgt rund 58 ha, ihre Höhe 54 m. Das Kraftwerk soll eine Leistung von 15 MW erhalten. Einteil des Windstroms soll gleich oben auf der halde produziert werden. Zusammenstellung: Matthias Brake, Bild: RWE
Bisher ist der Konzern am neuen Pumpspeicherkraftwerk Atdorf/Schwarzwald und am größten europäischen Pumpspeicherkraftwerk Vianden/Luxemburg beteiligt. Die Kohle-Abraumhalden des Ruhrgebietssollen jetzt als neue Wasserkraftstandorte für den Bau von Pumpspeicherkraftwerken zur Speicherung von regenerativ erzeugtem Strom dienen. Wasser soll dabei in künstlichen Seen auf der Haldenspitze gepumpt werden und bei Bedarf über stromerzeugende Turbinen wieder in Unterbecken abfließen.
RWE Innogy und RAG Montan wollen die Machbarkeit des Konzepts mit einem Versuchspumpspeicherkraftwerk auf der Abraumhalde Sundern bei Hamm/Westfalen erproben. Vorteil dabei: Es muss nicht in gewachsene Naturlandschaft eingegriffen werden, die Halden als Überreste des Bergbaus sind bereits vorhanden und bieten Höhendifferenzen bis zu 100 m. Als Bonus obenauf bedeutet diese Höhenlage auch im Flachland gute Windkraftstandorte. Das Pumpspeicherkraftwerk auf der Halde Sundern soll einen Speichersee mit 600.000 m³ Volumen und eine Leistung von 15 MW haben.
Diese Symbiose aus Bergwerkshinterlassenschaften als neue Standorte für die regenerative Stromerzeugung dürfte in Zukunft noch weiter ausgebaut werden. Gerade hat Nordrhein-Westfalen zum 20. Juli ein Wasserentnahmeentgelt eingeführt. Das heißt, dass Kohleunternehmen in Zukunft für das Abpumpen der Sümpfungswässer des Kohleabbaus 4,5 ct pro m³ Kubikmeter bezahlen müssen. Auch Brandenburg will in Zukunft auf 10 % des abgepumpten Wassers aus seinem Braunkohlebergbau Gebühren erheben. Damit werden Projekte wie Pumpspeicher in Braunkohlegruben und in Untertagebauen auch wirtschaftlich interessanter für die Kohleunternehmen, denn sie können so einen Teil der Wasserkosten als Energiedienstleister in Sachen Energiespeicherung und Bereitstellung von Spitzenstrom wieder hereinholen.
Die Windkraft als Lieferant der geplanten Pumpspeicher erholt sich gerade wieder von ihrer politisch verursachten Absatzflaute im vergangenen Jahr. Nach Auskunft des Windenergie-Institutes DEWI wurden im ersten Halbjahr 2011 in Deutschland 356 Windräder mit einer Leistung von zusammen 793 MW neu errichtet. Das sind 20 % mehr Windkraftleistung als im gleichen Vorjahreszeitraum. Geschätzt wird jetzt für das Gesamtjahr 2011 ein Zubau von 1.800 MW Windstromleistung. Im bisherigen Rekordjahr 2002 war es mit 3.240 MW fast doppelt so viel. Hermann Albers vom Bundesverband Windenergie fordert deshalb dass die Bundesregierung ihren bisherigen Schwerpunkt Offshore korrigiert und in Zukunft wieder mehr auf die Nutzung der Windenergiepotenziale an Land setzt.
Dies könnte in bundesweit einheitlichen Genehmigungsverfahren und einer niedrigeren Degression der EEG-Vergütung für Windstrom umgesetzt werden. Einige Bundesländer setzen dagegen deutlich auf den Ausbau der Windkraft. Schleswig-Holstein kündigte an, die installierte Windkraftkapazität in den kommenden Jahren zu verdreifachen, und Baden-Württemberg will die Windkraftleistung verzehnfachen (und käme dann auf eine installierte Leistung wie heute Brandenburg).
Der Straßenverkehr bleibt aber auch weiterhin die größte CO2-Schleuder. Die EU propagiert Biosprit als Lösung. Die Hoffnung der Verantwortlichen: so ließen sich bisherige Strukturen der Agrarförderung beibehalten und, quasi nebenbei, der klimaschädliche Güter- und Personenverkehr klimafreundlicher machen. EU-Agrarkommissar Dacian Ciolos gab bekannt, dass der Agrarsektor noch bis mindestens 2020 weiter fast die Hälfte des gesamten EU-Budgets erhalten soll, jedes Jahr 59,8 Mrd Euro. Kein Wunder, dass großes Interesse besteht, diese Geldquelle sprudeln zu lassen.
Dabei ist die Diskussion über die Umwelt- und Klimaauswirkungen der Biospritproduktion, von Raps- und Maisfeldern, in Europa selbst noch gar nicht richtig in Gang gekommen. In einer Art Verdrängungsreaktion liegt der Fokus bei der Betrachtung der Umweltverträglichkeit noch auf der Frage, inwieweit Biospritproduktion und Urwaldrodung in tropischen Lieferländern zusammenhängen. Klimapolitisch hat sich die EU aber bereits festgelegt und will bis 2020 den Anteil an erneuerbaren Energieträgern am Treibstoffmix auf 10 % anheben. In der herkömmlichen EU-Logik heißt das vor allem mehr Biosprit.
Der soll jetzt zumindest sichtbar sauberer werden. EU-Energiekommissar Günther Oettinger stellte dazu in Brüssel eine Menge neuer Biosprit-Label vor. Sie sollen als Nachweise dafür dienen, dass Biosprit 35% weniger Emissionen verursacht. Bedingung für die Label-Anerkennung sei außerdem gewesen, dass die Rohstoffe, aus denen die Biokraftstoffe hergestellt werden, nicht von Flächen stammen, auf denen vorher Regenwald wuchs. Doch statt eines einheitlichen Labels entschied sich die EU, um die Verwirrung komplett zu machen, dazu, neben einem eigenen auch noch sieben weitere Label anzuerkennen. Neben dem von der Bundesrepublik finanzierten ISCC-System sind das die Label Bonsucro EU, Greenergy, RTRS EU RED, RSB EU RED, 2Bsvs und RSBA – weitere können folgen. Dabei kommen andere Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass Biosprit zu gar keiner Emissionsminderung führt, sondern im Vergleich zu fossilen Treibstoffen 81-167 % mehr Emissionen verursacht.

Labelinflation á la EU-Kommission. Gleich sieben Biosprit-Label auf einmal erkennt die EU-Kommission seit letzter Woche an. Sie sollen anzeigen, dass der Treibstoff vom Acker 35% weniger Emissionen als fossile Treibstoffe verursacht und die Pflanzen nicht direkt auf frisch gerodetem vormaligem Regenwaldboden angebaut wurden. Zusammenstellung: Matthias Brake
Kerstin Meyer vom europäischen Dachverband Transport & Environment merkt zudem an, dass die Gütesiegel nur die direkte Herstellung von Biosprit berücksichtigen und indirekte Effekte außen vor lassen. Wahrscheinlich würden die Label deshalb dazu führen, dass Pflanzen für die Biospritproduktion in Zukunft dann eben auf Flächen angebaut werden, wo vorher Nahrungsmittel produziert wurden und die Nahrungsmittelproduktion dann auf neu gerodete Urwaldflächen ausweicht. Die Gütesiegel sagten nichts über die Effekte der zunehmenden Biospritproduktion auf den Lebensmittelsektor aus.
Statt dessen bräuchte es vor allem effizientere Fahrzeuge, um den Treibstoffverbrauch und die Emmissionen direkt und zeitnah zu senken. Grenzwerte für den Spritverbrauch und effizientere Fahrzeuge seien deshalb wichtiger als mehr Biosprit- und wichtiger auch als der propagierte Übergang zur Elektromobilität, denn effiziente herkömmliche Antriebe brächten sofortige Emissionsminderungen im Gegensatz zu den erhofften Einsparungen durch eine zukünftige Technologie mit ihren ganzen ungelösten Problemen von der Akkutechnik bis hin zum Aufbau einer neuen Ladeinfrastruktur.
Noch ein anderer Ansatz den Verkehr emissionsärmer zu gestalten, feiert gerade sein 10 jähriges Jubiläum, die Europäische Mobilitätswoche. Aus einer europaweiten Veranstaltung mit rund 320 Städten im Jahr 2002 hat sich die Europäische Mobilitätswoche zu einer Bewegung mit 2.221 teilnehmenden Städten, davon 754 in Europa, im Jahr 2011 entwickelt. Gezeigt werden jedes Jahr Fortschritte in Sachen nachhaltiger Mobilität. Dabei geht es nicht um das Verbot von Autos auf den Straßen und in den Städten, sondern um Gestaltungsmöglichkeiten eines gleichberechtigten Miteinanders, um neue Wegekonzepte, bessere Umsteigemöglichkeiten und auch neue und erst einmal ungewohnte Denkansätze wie das Shared-Space-Konzept, die auf der Mobilitätswoche gezeigt werden und Verbreitung in der Praxis finden. In Verbindung mit sparsameren Fahrzeugen werden sie zu mehr Klimaschutz im Verkehrssektor führen, als noch mehr Biospritlabel für Treibsoffe aus Raps, Soja, Zuckerrohr und Co.
Source : http://www.heise.de/tp/artikel/35/35232/1.html
Von : Matthias Brake in Telepolis > Energie > Wochenschau

by Daisymupp | Jul 23, 2011 | Energie und Klima, Erneuerbare Energien
Die Wellen im Baskenland sind berühmt. Vor allem schätzen Surfer die große nach links brechende Welle mit ihren Tubes vor dem Dorf Mundaka. Nicht weit entfernt von Mundaka liegt auch das Mutriku, wo kürzlich weltweit das erste kommerziell genutzte Wellenkraftwerk ans Netz gegangen ist. Dem Hafen vorgelagert wurde eine Mole errichtet, die es im wahrsten Sinne des Wortes in sich hat. Sie schützt nicht nur den Hafen vor den in stürmischen Zeiten haushohen Wellen, sondern im Inneren des Betonklotzes erzeugen 16 Turbinen nun 300 Kilowatt Strom.
Es weht ein lauer Südwind und das Meer schwappt nur lustlos gegen den grauen Betonklotz, der sich vor dem baskischen Dorf Mutriku mit einer Höhe von gut 16 Metern einen halben Kilometer in den Atlantik schiebt. Denn wenn Südwind aus Spanien weht, werden die Wellen in dem Dorf zwischen Bilbao und Donostia-San Sebastian klein geblasen. Dann kann man sich kaum vorstellen, dass es sich lohnen könnte, ausgerechnet hier das erste kommerzielle Wellenkraftwerk weltweit ans Netz gehen zu lassen.
Wellen sind nun vom Damm aus kaum auszumachen, in dessen zentralen Teil auf 75 Metern 16 Turbinen verteilt sind, die in seinem inneren Strom produzieren. Nur acht vergitterte Öffnungen weisen darauf hin, dass es sich nicht um eine gewöhnliche Mole handelt.

Mole mit Turbinen. Bild: Ralf Streck
Doch es gibt die Brecher von enormer Kraft. Sie werden wegen des Klimawandels auch hier immer stärker und höher. Etliche schwere Stürme, die in den letzten Jahren unter dem Namen “Ciclogenesis explosiva” in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen sind, zeugen davon. Die explosiven Zyklogenesen, die auch den Golf von Biskaya in den letzten Jahren immer öfter heimsuchen, haben wie 2009 viele Wellenbrecher an der Atlantikküste zerstört. Doch statt die alte Mole zu reparieren, entschlossen sich die Verantwortlichen zu einem Großprojekt. Die neue Mole, die dem Hafen vorgelagert ist, wurde auf eine Dicke von fast 7 Metern weiter verstärkt, damit der Damm auch Wellen mit einer Höhe von 9,2 Metern aushalten kann.

Das Wellenkraftwerk Mutriku bei richtigem Wellengang. Bild: Voith
Der Betreiber des Kraftwerks im Inneren der Mole ist der baskische Energieversorger “Ente Vasco de la Energía” (EVE). Er wurde 1982 von der baskischen Regierung zur Förderung erneuerbarer Energien gegründet. EVE hat in das Wellenkraftwerk von Mutriku 2,3 Millionen Euro investiert. Umgesetzt wurde das Projekt unter Mitwirkung von Voith Hydro, ein Gemeinschaftsunternehmen von Voith und Siemens. Gesetzt wird auf die OWC-Technologie (oscillating water column = oszillierende Wassersäule), welche die Firma seit zehn Jahren aus Forschungszwecken auf der schottischen Insel Islay mit dem Wellenkraftwerk Limpet betreibt.
Die 16 von Voith Hydro in dem Damm installierten Wellsturbinen bilden das Herzstück des Kraftwerks. Das Prinzip beruht darauf, dass die Wellen nicht direkt angezapft werden, sondern das Wasser in “pneumatische Kammern” (Betonröhren) gedrückt und im Wellental wieder herausgezogen wird. Damit wird die Luft in den Röhren komprimiert und zurückgesaugt, wodurch jeweils ein schneller Luftstrom entsteht, der die Wellsturbinen antreibt. Die produzierte Strommenge ist eher gering. Mit den bis zu 300 Kilowatt und der Jahresleistung von geschätzten 660.000 kWh können nur 250 Haushalte oder 600 der etwa 5.000 Einwohner in Mutriku mit Strom versorgt werden.

Hafen Mutriko Mole mit Turbinen im Hintergrund. Bild: Ralf Streck
Doch es geht darum, die Potentiale der Wellenkraftwerke auszuloten. Die Größe der derzeitigen Anlagen lasse noch keine Aussage zu, “ob das einer der wichtigen Energieträger der Zukunft ist”, so der Wellenkraftexperte Kai-Uwe Graw von der Technischen Universität Dresden. Er verweist dabei auf die ersten Windräder, die zunächst auch verhältnismäßig klein waren und wenig Leistung hatten. Doch ob das Kraftwerk in Mutriku nun unter kommerziellen Bedingungen funktioniert, könne jetzt bewiesen werden, meint Graw.

Einwehungsplatte. Bild: Ralf Streck
Der baskische Energieversorger hofft, dass 2.000 Betriebsstunden im Jahr zusammen kommen, in dem das Kraftwerk mit voller Leistung betrieben werden kann. Der EVE-Direktor José Ignacio Hormaetxe hat bei der Einweihung der Anlage erklärt, dass mit dem Wellenkraftwerk nicht nur der Weg für Privatfirmen geebnet, sondern auch der Anteil von erneuerbaren Energien am Strom-Mix im Baskenland gesteigert werden soll. Die kommerzielle Anlage wird im Betrieb durch Spezialisten der baskischen Universität studiert, um die Leistung der Turbinen zu steigern. Das ist dringend notwendig. Zwar hat EVE keine genauen Zahlen vorgelegt, räumt aber ein, dass diese Art der Stromerzeugung bisher sogar noch teurer ist als Strom aus Solarzellen.

Mole mit Turbinen. Bild: Ralf Streck
So verwundert es nicht, wenn Dr. Roland Münch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Voith Hydro, eine “angemessene Einspeisevergütungen für Wellenkraft” fordert. In Spanien, das viele Milliarden Euro für lange Jahre durch stark überhöhte Solarsubventionen gebunden hat, wird Wellenkraft wegen der praktisch leeren Kassen in der tiefen Wirtschaftskrise nicht gefördert.
“Das Projekt Mutriku zeigt: Unsere Technologie zur Nutzung der Wellenkraft ist kommerziell einsatzfähig und steht bereit für den weiteren Einsatz im globalen Markt”, erklärte Münch. Diese Entwicklung müsse gefördert werden, indem die richtigen politischen Rahmenbedingungen gesetzt werden, fügte er an. Denn die Firma spricht von einem gigantischen Potenzial. Das weltweite Potenzial der Meeresenergien liege bei 1,8 Terawatt und stehe erst am Beginn seiner weltweiten Erschließung. Münch hebt besonders hervor, dass die Technologie sowohl in bestehende Wellenbrecher und Hafenmauern als auch in Neubauten integriert werden kann. Damit ergebe sich eine hohe wirtschaftlich Synergie bei minimalen Eingriffen in die Umwelt.

Mole mit Turbinen. Bild: Ralf Streck
Doch in Mutriku kann von minimalen Eingriffen in die Umwelt nicht gesprochen werden. “Schön ist das nicht”, meint die junge Dorfbewohnerin Ainara Lertxundi. Sie zeigt auf den breiten Damm, der sich nun vor den Hafen schiebt und vielen den freien Blick auf das geliebte Meer versperrt. Viele im Dorf sehen das Bauwerk aus verschiedenen Gründen mit gemischten Gefühlen.
Wie die Umweltschutzorganisation Eguzki (Sonne) wandte sich auch die lokale Initiative Hobetu Leike gegen diesen Damm. Das hat nichts damit zu tun, dass hier eine neue Energieform genutzt wird und gleichzeitig die Fischerboote effektiv vor den Wellen geschützt werden. In dem Fischerdorf sehen das eigentlich alle als eine Notwendigkeit an. Viele stören sich eher daran, dass gleichzeitig noch ein Sporthafen geschaffen wird und der kleine Strand verschwunden ist.
Auch Eguzki hält es grundsätzlich für “positiv”, bestehende Anlagen zur Stromproduktion zu nutzen, und schlägt dafür auch Santurtzi, Bermeo, Orio oder Hondarribia vor, um in den Molen Wellenstrom zu produzieren. Doch letztlich einem Hafenausbau, wie in Mutriku, einen grünen Anstrich zu geben, “ist nicht der richtige Weg”, kritisiert die Umweltschutzorganisation. Letztlich wurden nur 2,3 der 6,7 Millionen Euro für das Kraftwerk ausgegeben. Die Organisation warnt vor einer Ausbreitung des Modells, wie es sich aus Ankündigung hochrangiger Politiker ableiten ließe. Mit derlei Bauwerken ließen sich “hohe Umweltkosten nicht rechtfertigen”, die zudem für viele Kontroversen sorgten.

Hafen Mutriko Mole mit Turbinen im Hintergrund. Bild: Ralf Streck
Einen wirklich starken Widerstand gab es in Mutriku gegen den Damm aber nicht. Im Gespräch mit den Bewohnern scheint sogar bei Zweiflern und Gegnern ein wenig stolz durch, dass hier vielleicht Historie geschrieben wird. Denn in einem Dorf wie Mutriku wäre ein solches Projekt in dieser Region nicht durchsetzbar, wenn es eine klare Ablehnungsfront gäbe. Das haben spanische Atomkraftwerksbetreiber teuer lernen müssen. In der Region waren einst drei Atomkraftwerke geplant. Trotz des massiven Widerstands wurde nur Lemoiz gebaut, das aber nie ans Netz gegangen ist.
Denn in Mutriku und der Region dominiert die kämpferische linke baskische Unabhängigkeitsbewegung. Das wird im Dorf schon dadurch deutlich, dass aus vielen Wohnungen Spruchbänder hängen, welche die Freiheit der politischen Gefangenen fordern. Den Gemeinderat dominiert klar die Linkskoalition Bildu (Sammeln), die 8 von 13 Gemeinderäten stellt. Die beiden großen spanischen Parteien kamen dagegen im Mai gemeinsam nur auf 3,5% der Stimmen.
Von der Ablehnung der großen Mole hat allerdings eine unabhängige linksgrüne Liste profitiert, die fast 9% erhalten hat. Statt des monströsen Damms hat die Liste nach holländischem Vorbild eine künstliche Insel als Wellenbrecher gefordert.
Source : http://www.heise.de/tp/artikel/35/35149/1.html
von : Ralf Streck in Telepolis > Energie